
ESSAY
 |
|
| START > ESSAY > UND COCA-COLA IST AUCH SCHON DA | |
ESSAY | |
 |
Und Coca-Cola ist auch schon da |
|
Seit das Reisen erfunden wurde, zieht es uns Menschen in die Fremde. Manche für immer, manche nur für den Urlaub. Fortgehen heißt, den Ort ausziehen, den man bewohnte, schrieb Saint-Pol-Roux dazu. JÜRGEN STRYJAK, zur Zeit in Kairo, weiß, wie schwer es ist, auch wirklich woanders anzukommen Martin. Ich kannte ihn, das heißt, ich kannte ihn nicht richtig, ich wußte nur seinen Namen und wie er aussah, weil er mir einmal eine Zeitlang ständig begegnete. Viele kannten nicht einmal seinen Namen, aber es gab wohl niemanden im Prenzlauer Berg der achtziger Jahre, dem sein Gesicht nicht vertraut war. Man konnte hinkommen, wohin man wollte, Kirchenlesungen, Wohnzimmer-Austellungseröffnungen, Jazzkonzerte in irgendwelchen kleinen Klubs, Martin war garantiert vor einem da. Immer. Schaute man genauer hin, konnte man beobachten, daß Martin selten mit jemandem sprach. Er stand einfach nur da, weite Latzhose, T-Shirt, Umhängebeutel aus Stoff. Keiner fand seine Anwesenheit merkwürdig. So schien es mir irgendwie sogar logisch, daß Martin, als ich vor zehn Jahren das erste Mal im oberägyptischen Luxor ankam, bereits ganz entspannt und wie immer schweigend in einem Straßencafé saß. Und auch, daß er am nächsten Tag 300 Kilometer weiter im Badeort Hurghada am Roten Meer auf einem Fahrrad an mir vorbeiradelte, Latzhose, T-Shirt, Umhängebeutel. Martin war immer der erste. An jenem Tag dachte ich darüber nach, daß es offensichtlich ein Kinderspiel ist, per Flugzeug, Hochgeschwindigkeitszug oder Schiff in die Ferne zu reisen, gleichzeitig aber bekam ich zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie schwer es war, auch wirklich ganz woanders anzukommen. Jahre später machte ich eine ähnliche Erfahrung. Auf dem Fährschiff vom Sinai nach Jordanien lernte ich Jack kennen, einen eher mittellosen Amerikaner, der sein Leben damit verbrachte, über die Kontinente zu reisen. Im jordanischen Aqaba teilten wir uns ein billiges Hotelzimmer, in Petra besuchten wir die Felsenstadt, in Amman trennten wir uns, weil ich weiter nach Syrien reisen wollte, er aber nicht. Fast eine Woche danach in Jerusalem setzte er sich ganz überraschend an meinen Cafétisch, und wieder eine Woche später kam er mir an der israelisch-ägyptischen Grenze entgegen und fragte, ob wir uns nicht das Taxi nach Nuweiba teilen wollten. Dort ging jeder seiner Wege, meiner führte nach fünf Tagen in die 16-Millionen-Metropole Kairo. Hier geschah es, daß wir uns zufällig am selben Schreibwarenstand, einem von womöglich Tausenden in Kairo, Ansichtskarten kauften. Als Reisender hat man es ohnehin schon nicht einfach. Schwer trägt man an seinen Erinnerungen und den Klischeevorstellungen über den Ort, an den man reist, zu schwer manchmal, um sich auf Neues und Fremdes einzulassen. Man nimmt Erfahrungen und Sorgen mit, seinen Lebensstil und die Kleider, Dinge, die man für die schönste Zeit des Jahres eigentlich vergessen oder wenigstens mal wechseln wollte. Und am Ende sind außer Martin und Jack auch alle anderen schon immer vor einem da: McDonald's und Coca-Cola, VISAcard und Marlboro — und die netten Hotelnachbarn aus Leipzig-Schkeuditz im Zimmer nebenan sowieso. Man muß sich schon einige Mühe geben, um etwas wirklich Besonderes und Fremdartiges zu erleben. Anfang der neunziger Jahre wollte ich den einzigartigen, oft beschriebenen Sonnenaufgang auf dem Berg Sinai sehen. Ich stellte mich auf ein einsames Erlebnis in einer verkarsteten Steinwelt in 3.000 Meter Höhe ein. Pünktlich nachts um drei wartete der angemietete Beduinenführer am Fuß des Berges und führte mich in einem Drei-Stunden-Marsch durch die schwarze Nacht bis auf den Gipfel. Doch was mußte ich bei meiner Ankunft auf dem Bergplateau sehen? Außer mir hatten noch mehrere hundert andere Touristen den Weg hinaufgefunden, unter ihnen eine japanische Reisegruppe, die — auch das noch — alle tatsächlich mit Fotoapparaten behangen waren. Und Coca-Cola gab es sowieso, an kleinen Ständen mit Keksen, Kodak-Filmen und Ansichtskarten. Natürlich war der Sonnenaufgang deshalb nicht minder eindrucksvoll, aber er war irgendwie nicht das, was ich erwartet hatte. Genau wie beim ersten Mal auf den Golan-Höhen. Musa, ein in Israel lebender palästinensischer Freund, hatte uns zu einer Fahrt mit seinem Auto durch den israelisch besetzten Landstrich eingeladen. Wir passierten Militärkontrollen, zerstörte Moscheen und mit Stacheldraht umzäunte Wehrdörfer israelischer Siedler. Aber gerade als wir an jenem Punkt angekommen waren, von dem aus man hinüber in die verlassene, teilweise verfallene syrische Stadt Quneitra sehen konnten, hielten hinter uns Reisebusse, die Drucklufttüren öffneten sich mit diesem bedrohlichen Zischen, und heraus quollen amerikanische, italienische und französische Touristen und überrannten uns förmlich mit ihren Videokameras und Reisehandbüchern bei ihrem Wettlauf auf die wenigen Panoramafernrohre, die irgendeine Tourismusbehörde dort aufgestellt hatte. Das Ganze kam mir vor wie eine Invasion von Marsmenschen. Natürlich ist es schön, daß die Menschen neugierig genug sind, um sich an Orten, wo es möglich und ungefährlich ist, ein eigenes Bild von dem zu machen, was sie sonst nur aus den Nachrichten kennen. Aber unsere aufregende Expedition durch einen der bekanntesten Krisenherde der Welt war mit einem Schlag zum sommerlichen Ausflug durch eine idyllische Heidelandschaft geworden. Gott sei Dank geht es mir immer noch so, wie vielen anderen, die ich kenne, daß mich vor jeder großen Reise die Unruhe packt, die ich aus Kindertagen kenne, als ich stundenlang Landkarten anschaute und von fremden Völkern und Landstrichen träumte. In Der Ausflug schreibt Saint-Pol-Roux: "Fortgehen heißt, den Ort ausziehen, den man bewohnte: seinen Hut des Kirchturms absetzen, seine Tunika aus Wiesen ablegen, aus seinen Ärmeln der Hügel schlüpfen, seine Hose aus Pfaden mit den bewohnten Taschen ausziehen; und man wird geographisch nackt bis zu dem neuen Ort, der uns den feinen Schleier seines Zaubers oder den schweren Mantel seines Schicksals reichen wird." Aber ich kann nicht leugnen, daß sich eine gewisse Routine eingestellt hat. Von meinem ersten London-Aufenthalt 1993 blieb mir statt der Museen, Kathedralen, Shopping-Viertel und Doppeldeckerbusse am intensivsten eine Frage in Erinnerung, die wir uns erst nachher stellten: Haben wir damals nun britisches Rindfleisch gegessen oder nicht? Paris war am erregendsten in jenem Moment, als mein Mobiltelefon klingelte und ein Freund dran war, der mich irgendwo in Berlin wähnte. "Du, Micha", rief ich, "ich bin in Paris. Ja, du hast richtig gehört! In Pariiiis!" Seitdem begegnen mir auf Reisen öfter Deutsche, die zitternd in ihren Taschen nach dem klingelnden Handy fingern, als könnten sie sich erst mit diesem Telefonat mit der Heimat der Tatsache versichern, daß sie auch wirklich ganz weit sind. Spätestens den drei, vier Generationen nach uns, prophezeit Paul Virilio, wird die Welt unglaublich eng und langweilig erscheinen. Immer öfter begegne ich Leuten, die gut erholt und mit vollen Fotoalben aus dem Urlaub wiederkommen, aber auf die Frage, wie es ihnen gefallen hat, nur mit einem müden "War ganz schön gewesen" antworten. Die rechte Begeisterung hat sich nicht eingestellt, der erwartete Kick blieb aus. An jedem x-beliebigen Wochenende verbringen rund 50.000 Deutsche ihre Ferien in dem kleinen ägyptischen Dorf Hurghada, dem neuen Bade-Hotspot am Roten Meer. An guten Tagen landen bis zu 36 Maschinen aus Hamburg, München, Berlin oder Leipzig. Die Ägypter stellen sich auf das ein, was die Fremden erwarten. Sie organisieren Dinnertouren zu echten Beduinenzelten, nach dem Essen findet schnell noch ein Souvenirverkauf statt, und 90 Minuten später steht der klimatisierte Bus für die Rückfahrt ins Hotel bereit. Nach zwei Wochen bleibt das Gefühl, trotz Tausender zurückgelegter Kilometer nicht wirklich vom Fleck gekommen zu sein. Wollten wir nicht eigentlich eine große Reise unternehmen? Statt dessen sind wir wieder nur in den Urlaub gefahren. Vielleicht ist das der Grund dafür, daß bei einem meiner Freunde aus dem Verreisen eine Sucht geworden ist. Er nennt sie Collecting Countries. Als ich vor drei Jahren das letzte Mal mit ihm verreiste, war er bei 36 Ländern angekommen. Wir mußten auf der Rückfahrt mit dem Auto aus der Schweiz unbedingt noch einen Zwei-Stunden-Abstecher nach Liechtenstein machen. Das Fürstentum wollte er auf jeden Fall als 37. Land noch mitnehmen. Eine meiner größten Reisen, auf die ich je ging, war gleichzeitig auch eine meiner kürzesten. Sie führte mich im Frühherbst 1989, noch zu Mauerzeiten, nach Westdeutschland. Den Reisepaß dazu hatte ich mir erschwindelt. Ein Freund arrangierte mir einen Brief aus Bremen, in dem sich eine Frau, die ich nicht kannte, als meine Cousine ausgab und mich zu ihrer Hochzeit einlud. Die entsprechenden Papiere waren beigefügt. Mit vor Aufregung feuchten Handinnenflächen erklärte ich der Beamtin auf der Volkspolizei-Meldestelle meine erlogenen Verwandtschaftsbeziehungen. Es klappte. Vier Wochen später konnte ich den Paß abholen. Kurz darauf, beim Frühstück mit Bekannten in Wiesbaden, las ich in der BILD-Zeitung: "Nächsten Mittwoch wird Honecker abgesägt." Wo immer ich mich demnächst noch irgendwie auf dieser Welt befinden werde, so weit weg wie damals in jenem Moment kann ich gar nicht wieder sein. Vor einigen Tagen kam mein Sohn aus seiner Schule hier in Kairo und erzählte, daß sie eine Berufsberatung mit Managern ausländischer Firmen wie Citibank Egypt oder Bayer Egypt hatten. Einer der Referenten gab den Schülern den Ratschlag, nach dem Abitur unbedingt eine Auszeit für eine Reise in die Ferne zu nehmen — um exotische Länder kennenzulernen und um Lebenserfahrung zu sammeln. In welche exotischen Länder, fragte mich mein Sohn etwas ratlos, sollte er nach dann zwei Jahren Ägypten nur reisen? Nach Mecklenburg-Vorpommern vielleicht?
Erschienen in "Das Magazin", Ausgabe September 2000. |
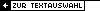 | 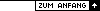 |