
PORTRAIT
 |
|
| START > PORTRAIT > WILLKOMMEN IN ABSURDISTAN | |
PORTRAIT | |
 |
AUSKÜNFTE |
Willkommen in Absurdistan |
|
Einmal Kairo und zurück. Wenn man woanders lebt, wird der Blick auf die alte Heimat genauer und gelassener. Wer zurückkehrt, erlebt die Bundesrepublik als Mischung aus Chaos und Schlaraffenland Texte: Jürgen Stryjak Seit einigen Jahren wohne ich in Grosny. Wir haben dort eine schöne, große, billige Wohnung mit drei Balkons. Junge Männer in schicken dunkelblauen Polo-Shirts liefern uns Corn Flakes, Persil, Clausthaler Bier und CD-Roms zum Selberbrennen im Zwölferpack an die Wohnungstür, wenn wir diese Sachen per Telefon beim örtlichen Supermarkt bestellen, auch um Mitternacht. Das Internet ist schnell und kostenlos, von der Gebühr für das Ortsgespräch mal abgesehen, und wenn wir zu faul zum Rausgehen sind, können wir uns dort online Pizza, Spaghetti, Hamburger oder sonst was zum Essen bestellen. An besonders heißen Tagen verbringen wir den Nachmittag manchmal in einer der unzähligen modernen Shopping Malls oder im Kino, weil beide wunderbar klimatisiert sind.  Wir wohnen natürlich "nicht wirklich" in der Trümmerlandschaft Grosny, sondern in Kairo, aber als ich vor kurzem nach Deutschland kam, las ich in der Zeitung, daß das irgendwie dasselbe sei. Das hatte ich gar nicht bemerkt. Der Autor schrieb, daß er ebenso nach Grosny hätte reisen können, statt wie angekündigt nach Kairo, die Reaktion seiner Bekannten wäre kaum anders ausgefallen. "Man muß doch sein Schicksal nicht herausfordern." Seit diesem Artikel fühlen wir uns wieder verwegen und mutig, das Abenteuer Kairo drohte schon zu verblassen. Über die Jahre hatten wir gesehen, daß das Leben von Ahmed Normalverbraucher im Grunde ähnlichen Mechanismen folgt wie wahrscheinlich fast überall auf der Welt, und daß die Leute halt damit beschäftigt sind, fürs alltägliche Durchkommen zu sorgen, ein wenig Vergnügen inbegriffen. Wie wir auch. Unser neues Abenteuer nun ist die Rückkehr. Wir wohnen zwar immer noch in Kairo, aber aus bestimmten Gründen verbringen wir neuerdings mehr als nur drei Sommerwochen in Deutschland, Gelegenheit genug, um genauer darauf zu schauen, was aus diesem Land inzwischen geworden ist. Eine meiner dramatischsten Erfahrungen war, zu erleben, wie schnell sich während der paar Jahre Abwesenheit die Floskel "nicht wirklich" ausgebreitet hat, jeder Zweite verwendet sie in fast jedem dritten Satz. Ich nehme an, daß sie aus dem Englischen zu uns kam, denn das entsprechende "not really" hatte ich bei Amerikanern in Kairo oft gehört. Irgendwann muß die Floskel mutiert und übergesprungen sein und hat dann rasend wie der Panama-Grippevirus die Deutschen befallen. Hast du Lust, mit mir übers Wochenende einen Ausflug zu machen? "Nee, nicht wirklich!" Hat die neue Brigitte-Diät bei dir angeschlagen? "Oje, nicht wirklich." Glaubst du noch daran, daß demnächst alles wieder besser wird? "Nicht wirklich." Das ist durchaus kurios, denn verglichen mit dem Leben in fast allen anderen Ländern der Welt, müßten die Deutschen eigentlich fortwährend "super", "klasse" oder wenigstens ein nachsichtiges "Ist schon okay" sagen. Wenn "Wahnsinn" das Wort der Wende war, dann ist "nicht wirklich" ganz eindeutig Deutschlands Floskel der Rezession. In Kairo antwortet jeder auf die Frage, ob es ihm gut geht, unabhängig davon, wie ihm tatsächlich zumute ist: "Gott sei gepriesen!" Das Deutschland, aus dem wir weggegangen sind, war, um einen Satz Hemingways abzuwandeln, ein sauberer, aufgeräumter, gut beleuchteter Ort, an dem man, wenn auch nicht ohne Probleme, so doch einigermaßen zufrieden leben konnte. Das ist es ganz zweifelsohne auch heute noch. Trotzdem scheint plötzlich irgendein böser Voodoo-Zauber über die Leute gekommen zu sein. Wann immer ich in Berlin durch Straßen laufe, wo Menschen andernorts in der Welt entspannt an Schaufenstern entlangbummeln, fällt mir der Streifenpolizist ein, den ich in einer Karikatur gesehen habe und der die Passanten anherrscht: "Nun flanieren Sie schon! Sie sollen flanieren, hab' ich gesagt!" Die Leute wirken gehetzt und griesgrämig, als sei die Mühsal dieser Erde auf ihnen abgeladen worden. In Kairo habe ich mir angewöhnt, wildfremden Menschen im Krämerladen oder im Bus zu erzählen, was mir heute und gestern für komische Sachen passiert sind. Das tun da alle, und diese neue Eigenschaft hat so gründlich von mir Besitz ergriffen, daß ich das auch in Berlin so mache - mit dem Ergebnis, daß man betreten an mir vorbeischaut oder aufsteht und sich auf einen anderen Platz setzt. Nun sind wir Deutschen ja generell nicht gerade für übersprudelnde Lebensfreude bekannt, aber ich kann mich erinnern, daß die Menschen in den Neunzigern durchaus viel neugieriger auf- und offener zueinander waren, eine Zeit des Leichtsinns und des Optimismus, nahezu mediterran, wenn ich allein an die Reichstagsverhüllung, die Love Parade der ersten Jahre, den Aktienboom, den Internetwahn denke. Inzwischen scheint es, als haben die Deutschen dieses kurze Zwischenspiel wie eine Probepackung an der Kasse zurückgegeben: Was sollen wir damit, wenn doch alles immer schlechter wird? Es ist ja bislang nicht richtig schlecht geworden. Solange - nicht nur in Werbespots - Frauen entnervt in den Kleiderschrank starren und "Ich hab' nichts anzuziehen rufen" rufen, während es im Land an Boutiquen wimmelt, und solange auf Ämtern notfalls Kleidergeld gezahlt wird, kann es so schlimm nicht sein. Inzwischen habe ich sogar Spaß daran, den Leuten beim Jammern zuzuhören. Wenn Bekannte auf die deutschen Behörden zu sprechen kommen, sacken sie entmutigt zusammen und klagen. Ich hingegen würde gern mal ägyptische Freunde auf ein Berliner Amt mitnehmen. Die könnten denken, sie seien an der Rezeption eines Fünf-Sterne-Hotels gelandet. In den letzten Wochen erlebten meine Frau und ich, daß ständig irgendwas nicht klappt. Wir versuchen uns an die Zeit zu erinnern, als wir Deutschland für eine Oase der Perfektion hielten. Jetzt müssen wir ständig Rechnungen reklamieren, von der Telekom zum Beispiel oder von der Krankenversicherung. Eine Broschüre, die ich bestellt hatte, war nach einem Monat und fünf Telefonaten immer noch nicht eingetroffen. Dreimal versuchten wir, mit dem Airport-Express zum Flughafen rauszufahren, zweimal mußten wir stattdessen ein Taxi nehmen, weil der Verkehr komplett kollabiert war, einmal schickte uns die Bahnsteigansage zu einem völlig falschen Ersatzverkehr. Zweimal in vier Wochen war der DSL-Internetzugang im Raum Berlin für einen Tag zusammengebrochen. Davon, daß Handwerker nicht mehr pünktlich kommen, ganz zu schweigen. Wir finden das irgendwie amüsant und sagen dann immer mit gespielter Entrüstung: "Typisch Ägypten!" Schließlich durften wir dort Katastrophenmanagement bereits trainieren. Den Nörglern könnte man sagen: Willkommen im Club! So ist das nun mal im wirklichen Leben. Nun auch in Deutschland. Seit wir eine Weile weg waren, erleben wir es als eine Mischung aus Absurdistan und Schlaraffenland. Das finden wir ziemlich ulkig, und derart gut unterhalten kann man auch viel lockerer mit den wirklichen Problemen und Nöten umgehen. Neulich sah ich auf RTL bei "Deutschland sucht den Superstar", wie ein Teenager vom Lande ins Mikrofon kreischte: "Alex finde ich toootal geil! Juliette dagegen ist so provinzionell!" Dieses schöne neue Wort hat uns sehr gefallen. Man könnte auch sagen: Deutschland ist so provinzionell. Nicht wirklich, oder?
|
Und was sagen andere Rückkehrer? |
 Sibylle Müller, 42, nach sechs Jahren Moskau und sechs Jahren Istanbul: Fast ein Drittel ihres Lebens verbrachte sie im Ausland, sechs Jahre in Moskau, sechs in Istanbul. Gleich nach der Wende hatte sie sich mit ihrem Mann auf dem Weg in die große weite Welt gemacht. Vor einem Jahr kehrte sie nach Deutschland zurück. Vielleicht war die Welt ja auch in Berlin-Köpenick inzwischen groß und weit geworden. Ihr Wohnzimmer ist komplett türkisch eingerichtet, mit Schränken, Sesseln und Anrichten aus Istanbul. Es sieht verblüffend deutsch aus, aufgeräumt und irgendwie edel, ein Ort zum Wohlfühlen. Aber Sibylle Müller sagt: "Ich bin bis jetzt nicht wieder richtig angekommen." Und: "Wenn ich mich amüsieren will, dann fliege ich nach Istanbul." In Berlin will sie ihre Freunde überreden, was zu unternehmen, essen zu gehen, auszugehen, aber Deutschland scheint das Land der Ausreden und Entschuldigungen zu sein - das Geld, die Figur, die Arbeit. "Die Leute sagen: Ich darf nicht so viel essen, ich war heute nicht zum Sport." Oft glauben sie, früh ins Bett zu müssen, um am nächsten Morgen im Büro fit zu sein. "Dabei kann man doch, wenn man einen tollen Abend hatte, am nächsten Tag noch viel besser arbeiten." Wenn Sibylle Müller bei Bekannten zu Besuch ist, kommt es vor, daß die Gastgeber nach dem Essen aufstehen, das Geschirr in die Küche räumen, den Tisch säubern und sagen: "So, jetzt kann der gemütliche Teil des Abends beginnen!" Wie absurd, denkt sie dann, man kann es doch immer gemütlich haben, essen, trinken, rauchen, lachen und feiern, alles gleichzeitig, alles durcheinander. Sicher war das hier schon immer so, aber die Jahre unter Menschen, die mehr Probleme haben, aber weniger verbissen sind, haben ihr gezeigt: "Man kann sich auch abstoßen und schweben. Wenn man will." In Deutschland müsse alles vorbestellt, koordiniert und terminiert werden, überall braucht man Termine und muß sich auf Wartezeiten einstellen. "Aber Fräulein, sage ich zur Friseuse, das dauert doch nur zehn Minuten, nur ein bißchen glattschneiden. Trotzdem kriege ich einen Termin für eine Woche später." Auf die Möbel, die sich ausgesucht hatte, mußte sie einen Monat warten. Und auch Freunde gucken in den Terminkalender, wenn sie sie fragt, wann man sich denn mal treffen könnte. "Nee, diese Woche nicht. Da bin ich so im Streß, sagen die dann. Sie vergessen einfach, zwischendurch zu leben!" Kürzlich las Sibylle Müller die Auslandsstellenangebote des Deutschen Entwicklungsdienstes. Laura, die Tochter, schaute ihr über die Schultern und sagte: "Mama, nun versuch es doch wenigstens erst mal in Deutschland!"  Arne Behnck, 38, nach sechs Jahren London: Sechs Jahre hat der Kleinunternehmer Arne Behnck in London gelebt. Ein paar Tugenden, die Engländer für typisch deutsch halten, Effizienz, Korrektheit, waren sein Vorteil. Während sich britische Handwerker morgens vor dem Termin noch rasch einen Winkelschneider ausleihen, startete Arne Behnck mit einem voll ausgestatteten Wagen inklusive eigenem Werkzeug eine erfolgreiche Fliesenleger-Karriere in London. Auf das Lebensgefühl der Deutschen scheinen sich diese Tugenden wie Blei zu legen. "In Deutschland können die Leute nicht miteinander leben. Alles ist anonymisiert. Auch der Kontakt zwischen Handwerker und Kunde." In London bekam der Fliesenleger Behnck morgens um sieben den Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt und gezeigt, wo Kaffee und Kekse stehen. Er arbeitete oft allein in der Wohnung, den ganzen Tag über oder sogar während ganzer zwei Wochen, wenn der Auftraggeber verreist war. Im März 2002 kehrte Arne Behnck nach Berlin zurück, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte, einer Halbbritin. Im Vergleich schneidet Deutschland nur selten positiv ab: "Die Wohnungen sind viel besser als die der Briten." Er eröffnete Antico, ein kleines schickes Unternehmen für Fußbodendesign. In einer Galerie in der Berliner Gipsstraße stellt er edle Materialien aus, von Marmor bis Granit, die er weltweit einkauft. Eigentlich findet er im Rückblick, daß die Briten ein aggressives, arrogantes Volk sind. London sei teuer und schnell, nichts für bequeme Menschen, trotzdem kam ihm das Leben dort irgendwie leichter, unkomplizierter vor. In Deutschland muß man beweisen, daß man nichts Böses im Schilde führt. Der Alltag sei eine ständige Bewährungshaft, eine permanente Unterstellung. Papiere müssen beglaubigt werden, nette Gesten, einfach so als Vorschuß, sind selten. Vertrauen muß man sich mühsam erwerben. Man könnte ja ein Trickser oder Betrüger sein. "Wenn ich in England zeige, daß in meinem Führerschein ein Foto von mir klebt, lachen alle: Führerschein mit Bild - was für Nazimethoden!" Dani Reuter, 25, nach sieben Jahren Tel Aviv: Sieben Jahre lebte Dani Reiter in Tel Aviv, im Land seiner Eltern, vor sechs Monaten kehrte er nach Deutschland zurück. In Berlin geboren, besitzt Dani Reiter die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft. Er schwärmt davon, wie gut man in Tel Aviv flirten kann, wie zugänglich die Frauen sein, und bedauert, daß die Leute in Berlin sich so kalt und verklemmt verhielten, als hätten sie vor etwas Angst. "Man muß auf die kleinsten Zeichen und Signale achten." Berlin hat kaum Bewegung, wenig Flair, die Supermärkte schließen am frühen Abend und die Autos fahren schnell und aggressiv, aber Dani Reiter fiel es leicht, sich hier wieder einzuleben. "Berlin ist fast selbstvergessen. Umweltbewußtsein spielt eine große Rolle, die Behördengänge sind angenehm, verglichen mit denen in Israel, alles folgt festen Regeln." Vor allem aber der Lebensstandard bewog ihn zurückzukehren. In Schöneberg bewohnt er mit einem Kumpel ein Mansarden-Loft - drei alte Ledersofas, vollgekramte Zwischenböden, Matrazen auf dem Fußboden, Küche, Bad und Atelier. Sein Geld verdient er mit Assistentenjobs bei Fotografen und in der Zukunft vielleicht mit eigenen Arbeiten. Es reicht, um den Alltag einigermaßen entspannt zu verbringen. Das ist mehr, als die meisten Israelis erwarten können. Das eckige Denken der Deutschen, wie Dani Reiter es nennt, hat Vorteile: Man findet fast immer irgendeine Nische, in die man wie maßgeschneidert hineinpaßt.  Tom Levine, 38, nach fünf Jahren London: Als Tom Levine vor kurzem nach Berlin kam, empfing ihn eine Stadt der Behäbigkeit. Alle hier schienen auf etwas zu warten. In London, wo er mehrere Jahre lebte, laufen die Menschen die Rolltreppen hoch und die Laufbänder entlang, um schneller ans Ziel zu gelangen, hier lassen sie sich gemächlich bis ans Ende kutschieren. Bevor er wegging, war er "eine Art deutscher Patriot", stolz auf die vielen sozialen Polster und Bandagen. Das Leben in der britischen Metropole sei ungeduldiger und härter, "was durchaus nicht schön ist", aber im Gegensatz zu Berlin sei London eine Art Durchlauferhitzer, der alle in Bewegung bringt. "Die Londoner machen, die Berliner warten ab." Und nörgeln gern: "Die U-Bahn in London ist schlecht, dreckig und klapprig, aber wenn in Deutschland mal ein schicker ICE fünf Minuten zu spät kommt, dann meckern alle, auf hohem Niveau." Die deutsche Bushaltestelle ist für den 38jährigen Parlamentsredakteur der "Berliner Zeitung" geradezu eine Metapher für deutschen Stillstand. "Sie besitzt ein riesiges Fundament und eine doppeltsandstrahlgeschliffene Glasrückwand. In London reicht das Halteschild." Meistens trägt Tom Levine Anzug, fast immer mit Krawatte, im Grunde könnte er zu jedem Zeitpunkt losgehen und das "heute journal" moderieren, zum Beispiel. Für viele Deutsche ist Anzug purer Kapitalismus, ideologiebefrachtet. "Sie stellen immer alles in Frage und sind skeptisch."
Erschienen in "Das Magazin", Ausgabe April 2003. Die Portraits im letzten Teil des Beitrages wurden von Dietmar Spolert fotografiert. |
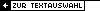 | 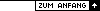 |